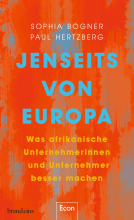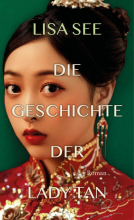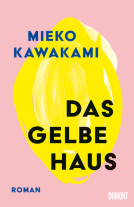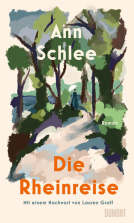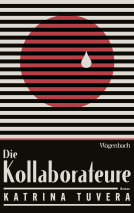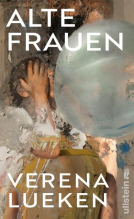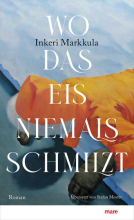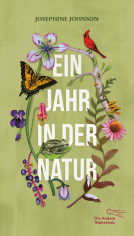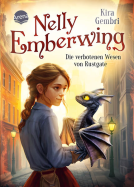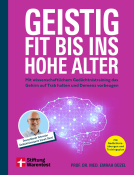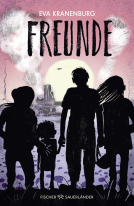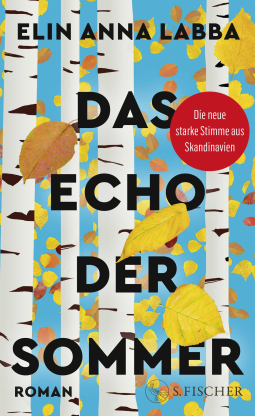
Das Echo der Sommer
Roman | Über die Lebenswelten der Sámi ‒ von der neuen starken Stimme aus Skandinavien
von Elin Anna Labba
Dieser Titel war ehemals bei NetGalley verfügbar und ist jetzt archiviert.
Bestellen oder kaufen Sie dieses Buch in der Verkaufsstelle Ihrer Wahl. Buchhandlung finden.
NetGalley-Bücher direkt an an Kindle oder die Kindle-App senden.
1
Um auf Ihrem Kindle oder in der Kindle-App zu lesen fügen Sie kindle@netgalley.com als bestätigte E-Mail-Adresse in Ihrem Amazon-Account hinzu. Klicken Sie hier für eine ausführliche Erklärung.
2
Geben Sie außerdem hier Ihre Kindle-E-Mail-Adresse ein. Sie finden diese in Ihrem Amazon-Account.
Erscheinungstermin 23.04.2025 | Archivierungsdatum 22.06.2025
Zum Inhalt
Vor einem Panorama überwältigender Natur – drei unnachgiebige Frauen einer sámischen Familie kämpfen um ihre Heimat
Jedes Jahr im Frühling kehren sie nach dem Winter in ihr »Sommerland« am See im Nordwesten Schwedens zurück. Doch in diesem Frühjahr ist alles anders: Als die dreizehnjährige Iŋgá mit den Rentieren, Mutter und Tante das Tal erreicht, ist ihr Dorf versunken. Birken, Hütten, das Hab und Gut der Familie und vor allem das Grab des Vaters – alles unter Wasser, rücksichtslos geopfert für die Wasserkraftproduktion und den Profit der Städte im Süden. Es beginnt ein jahrzehntelanger Kampf gegen die Mächtigen des Landes, der nicht nur die drei Frauen, sondern das ganze sámische Dorf vor eine Zerreißprobe stellt.
Elin Anna Labba erzählt die weitgehend unbekannte Geschichte ihrer Gemeinschaft und schafft ein unvergessliches Zeugnis für das Recht auf Selbstbestimmung und die tiefe Verbundenheit von Mensch und Natur. Ein hochaktueller Roman von ungeheuer erzählerischer Kraft.
Vor einem Panorama überwältigender Natur – drei unnachgiebige Frauen einer sámischen Familie kämpfen um ihre Heimat
Jedes Jahr im Frühling kehren sie nach dem Winter in ihr »Sommerland« am See im...
Verfügbare Ausgaben
| AUSGABE | Anderes Format |
| ISBN | 9783103976779 |
| PREIS | 24,00 € (EUR) |
| SEITEN | 464 |
Auf NetGalley verfügbar
Rezensionen der NetGalley-Mitglieder
 Simone F, Rezensent*in
Simone F, Rezensent*in
Seit ich letztes Jahr von Ann-Helen Laestadius „Zeiten im Sommerlicht“ gelesen habe, interessiere ich mich für die Geschichte der Samen. Diese wurden über Jahrhunderte systematisch diskriminiert, und die Samen kämpfen zum Teil bis heute um Anerkennung und den Erhalt ihres Lebensraumes.
„Das Echo der Sommer“ thematisiert die rücksichtslose Flutung samischer Dörfer in Schweden, um den steigenden Energiebedarf des Landes durch Wasserkraft zu decken. Immer wieder werden zwischen 1923 und 1972 Staudämme errichtet und erhöht. Die Auswirkungen auf die Samen sind massiv: Weidegrund für die Rentiere verschwindet, der Fischfang als Lebensgrundlage gerät in Gefahr, da sich die Gewässer verändern, und die Dörfer mit den traditionellen Koten versinken im gestauten Wasser. Entschädigungen gibt es keine bzw. erst ab 1972, und diese sind minimal.
Bei der Lektüre dieses Buches bin ich durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Es hat mich richtig wütend gemacht zu lesen, wie herablassend und respektlos die Samen behandelt wurden. Entscheidungen würden über ihre Köpfe getroffen, und sie hatten (als gesamtes Dorf) sogar einen gesetzlichen Vormund, der ihre Interessen „vertrat“. Jeglicher Fortschritt wurde ihnen verwehrt, insbesondere auch der Anschluss an das Elektrizitätsnetz, für das sie so viel opfern mussten. Auch wurde ihnen untersagt, in rechteckigen Häusern zu wohnen, sogar Fenster waren verboten. Das ist aus heutiger Sicht unfassbar, massiv diskriminierend und widerspricht jeglichem Gerechtigkeitsempfinden.
Gleichzeitig war ich sprachlos, wie gelassen und geradezu demütig die Samen diese Behandlung hinnahmen und als gottgegeben akzeptierten. Wer protestierte und sich zur Wehr setzte, wurde zum Außenseiter bzw. zur Außenseiterin in der Gemeinschaft. Es fiel mir daher schwer, mich in die Protagonistinnen hineinzuversetzen, da mir diese Ergebenheit völlig fremd ist. Gerade Inga, die junge Tochter, hätte ich manchmal am liebsten wachgerüttelt: Wo bleibt ihr Kampfgeist? Was ist mit ihrer Lebensplanung? Warum organisiert man sich nicht strategisch über die Dörfer hinweg zu einem großen konzertierten Protest, macht international auf sich aufmerksam? (Zumindest in den späteren Jahren, bei den Flutungen in den 1940ern war durch den Zweiten Weltkrieg der Fokus der Allgemeinheit auf den Krieg gerichtet). Aber vermutlich ist meine Denkweise viel zu modern geprägt und setzt auch ein gewisses Maß an Bildung und Rechtswissen voraus, das den Samen ebenfalls verwehrt wurde. Der innere Widerstand ihrer Mutter Ravdna war für mich viel besser verständlich, aber auch bei ihr habe ich einen echten Plan, eine Strategie, vermisst.
Elin Anna Labba schreibt in einer sehr poetischen Sprache, Schilderungen der Natur nehmen großen Raum ein und in jedem Satz ist die tiefe Verbundenheit zwischen den Samen und der Natur, ihrer Demut gegenüber der Schöpfung spürbar. Ich muss gestehen, dass mir das manchmal zu viel wurde und ich lieber in einer etwas nüchterneren Sprache mehr über die Flutungen, die weiteren Lebensumstände und die rechtliche Situation der Samen in Schweden erfahren hätte. Das Buch fokussiert vor allem auf die Wahrnehmungen und Empfindungen von Ravdna und Inga, selbst ihr Alltag als Samen bleibt relativ vage.
Der Text ist immer wieder durchsetzt von samischen Sätzen und Begriffen. Hier hätte ich mir ein Glossar am Ende des Buches mit Erklärungen gewünscht.
Fazit: Ein sehr aufwühlendes Buch, das die Diskriminierung der Samen im 20. Jahrhundert thematisiert und den Samen eine Stimme gibt. Insbesondere für alle, die ein Faible für poetische Sprache haben, ein sehr lesenswertes Buch.
Indigene Völker haben es schwer. Nicht nur in den USA. Auch die nordischen Länder gehen nicht gerade behutsam mit ihren Vorfahren um. Hier sind es Samen, die gegen Politik und Wirtschaft zu kämpfen haben. Immer wieder müssen sie das Fluten ihrer Dörfer erdulden. Dabei haben sie sich Hütten gebaut und leben gut vom Fischfang und ihren Rentieren. Es gibt etliche Leute, die ihre Hütten als primitiv und kaum bewohnbar ansehen. Aber Inga und ihre Lieben empfinden das ganz anders. #DasEchoderSommer gibt ihnen eine Stimme.
Was mag in den Köpfen der Menschen vorgehen, die seit Jahrhunderten in einem Land leben? Dieses als ihr Zuhause ansehen und plötzlich geradezu überfallen werden? Wenn Leute zu ihnen kommen und behaupten, dass sie es nur gut mit ihnen meinen? Dass sie ihnen Fortschritt bringen und den Verlust ihrer Heimat mit Geld ausgleichen möchten? Nein, diese Männer und Frauen hatten keine Lobby. Sie mussten der Macht, die leider immer auch mit Geld in Verbindung gebracht wird, weichen.
Das Buch ist keine leichte Lektüre, die ich innerhalb weniger Stunden „verschlungen“ habe. Zu ernst ist das Thema und das Schicksal der Samen berührte mich sehr. Immer wieder fragte ich mich, welches Recht sich diese Architekten der Industrialisierung herausnahmen. Sie sahen die Samen als einfältig an und gönnten ihnen noch nicht einmal ein Haus aus Stein. Warum nicht? Keiner weiß es. Für diesen Roman gebe ich eine Leseempfehlung und das ohne Abstriche. #NetGalleyDE
Erstmal zum Cover. Das ist richtig klasse. Dir Birkenstämme mit dem fallenden Laub vor blauem Hintergrund ist schon sehr schick und stimmt auch gut auf die Geschichte ein.
Es erzählt die Geschichten der Sámi und ihren Kampf um ihr Überleben. Wir begleiten Inga, ihre Mutter Rávdná und deren Schwester Anne über mehrere Jahrzehnte und erleben mit, wie ihre Koten immer wieder geflutet werden, weil der Staudamm immer wieder erhöht wird, um mehr Wasserkraft zu produzieren. Aber Rávdná ist eine Kämpferin und sieht nicht ein, warum sie auf ihr Land verzichten soll. Die Regierung ist allerdings der Meinung, dass das Land gar nicht den Sámi gehört.
Allein schon der Schriftverkehr, den es hauptsächlich in einseitiger Richtung gibt, ist äußerst fragwürdig. Dort wird den Sámi zum Beispiel abgesprochen, ein Haus zu bauen und sich um dieses auch zu kümmern. Zumal davon ausgegangen wird, dass die Lappen nicht dazu geschaffen sind, sesshaft zu werden.
Aber Ingas Mutter gibt nicht auf und kämpft weiter. Irgendwann erhält sie auch die Unterstützung ihrer Landsleute und schafft es tatsächlich, sich ein wenig aufzulehnen, meist dadurch, dass sie die Schreiben ignoriert.
Auch wenn die Verbindung zwischen Inga und ihrer Mutter nicht so tief zu sein scheint, so sind sie sich doch darin einig, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen.
Es ist wieder einmal der Beweis, dass es doch in jedem Land, in dem es Naturvölker gibt, der Regierung nicht nötig scheint, sich für diese einzusetzen oder ihnen auch nur zuzuhören. Eigentlich ziemlich doof, denn von diesen Völkern könnten wir ja tatsächlich etwas lernen und hätten somit vielleicht die passenderen Ideen, wie wir wieder im Einklang mit Mutter Natur leben könnten.
Traurig, dass es heutzutage nur noch um Profit geht und die Stimmen derer, die noch wissen, wie es besser geht, langsam verstummen.
Fazit:
Es hat mich tief bewegt, zu sehen, dass es auch in den nordischen Ländern nicht besser zugeht, als anderswo. Und das wir bisher die Volksgruppe der Sámi gar nicht auf dem Schirm hatten. Endlich erhalten sie auch eine Stimme.
Kein einfacher Roman. Sehr wortgewaltig... sehr imposant im Geschehen.
Kaum hatte uch mit dem Lesen des Buches beginnen wollte ich nicht mehr aufhören. Die Thematik war ehrlich gesagt gar nicht so meins. Jedoch konnte mich der Schreibstil von sich überzeugen und derart Fesseln, dass ich das Buch ziemlich schnell durchgesuchtet hatte.
Klare Kauf- und Leseempfehlung von meiner Seite aus.
 Ingeborg J, Buchhändler*in
Ingeborg J, Buchhändler*in
Ein großartiges stilles Leseerlebnis! Ein See, der erzählt, drei Frauen und die Natur - ich war zutiefst berührt von der Langsamkeit des Erzählens, vom Leben und der Geschichte der Samen. Ein großes Geschenk an alle Lesenden.
 Friederike B, Buchhändler*in
Friederike B, Buchhändler*in
Hilflos müssen die 13jährige Inga, ihre Mutter Ravdna und ihre Tante Anne zuschauen, wie ihre Torfkote - ihr Zuhause in den Sommermonaten - im aufgestauten See versinkt und mit ihr die Habseligkeiten der Familie, ihre Erinnerungen und ihr bisheriges Leben.
Bereits mehrfach hat das Energieunternehmen den Staudamm erhöht, auch jetzt im Jahr 1941 ist es wieder soweit. Um das Land mit mehr und mehr Strom versorgen zu können, werden hoch im Norden Seen gestaut und in der Folge Sami-Dörfer überflutet. Die Sami selbst werden nicht gefragt.
Ravdnas Versuch, einen Baukredit für ein neues, festes Haus höher im Fjell zu bekommen, scheitert. Der vom Staat für sie bestellte Vormund teilt ihr mit, dass die Lappen nicht sesshaft werden sollen. "Ihr Streben nach besseren Lebensbedingungen ist in einem Ausmaß gewachsen, das wir nicht gutheißen können."
Dabei haben sie schon lange das gänzlich nomadische Leben aufgegeben, wohnen im Winter in einer Baracke und leben im Sommer als Fischerinnen in der Kote am See.
Nutzen dürfen sie den erzeugten Strom auch nicht. Nur wer Grund und Boden besitzt, wird auch ans Stromnetz angeschlossen.
"Das Echo der Sommer" folgt den Frauen und ihrem Kampf bis in die späten siebziger Jahre. Poetisch, kraftvoll und aufwühlend erzählt Elin Anna Labba von Frevel an Umwelt und Menschen. Von der Zerstörung eines Lebensraumes für Tiere und Menschen, dem Verlust von Gemeinschaft, Kultur und Identität. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte Schwedens, das man in Deutschland kaum kennt und das nicht so recht zum positiven Image als umweltbewusstes, soziales Vorzeige-Land zu passen scheint.
Trotzdem ist es kein negatives Buch. Vielmehr zeigt es voll Zärtlichkeit und Melancholie die enge Verbindung von Mensch und Natur.
Für Leser von Maja Lunde, Mikael Niemi und Louise Erdrich.
 Rezensent*in 1502785
Rezensent*in 1502785
Ein sehr einfühlsames Buch über das Leben der Samen. Historisch gesehen sind sie Fischer und Jäger, doch früher waren die meisten von ihnen Nomaden, die ihren Rentierherden folgten.
Mit einer wundervollen Sprache wird über das vertreiben eines alten Stammes geschrieben und die langsame und gewaltsame Ausrottung ihres Lebensraumes.
Einzig hat mich an diesem Buch gestört, das ich sehr viele Wörter nachschlagen musste, die leider nicht übersetzt wurden.
 Nina L, Buchhändler*in
Nina L, Buchhändler*in
Dieser leise erzählte Roman bringt den Leser:innen eine Lebensweise näher, die uns unbekannt ist - und das, obwohl die Geschichte in einer nahen Vergangenheit spielt. Die Natur ist nicht nur Kulisse, sondern wie eine eigenständige Figur, mit der die anderen Figuren interagieren. Ein faszinierendes Buch, das nachwirkt.
 Buchhändler*in 1678251
Buchhändler*in 1678251
Zu Beginn brauchte ich etwas, um in den Roman zu finden, aber dranbleiben hat sich gelohnt.
Gemeinsam mit drei samischen Frauen aus zwei Generationen, die Schwestern Ravdna und Anne, sowie Ravdnas Tochter Inga erfahren wir, als diese aus dem Winterlager in ihr Sommerlager zurückkehren, dass dieser Ort von der Regierung geflutet wurde. Der angrenzende See wurde zu einem Stausee für die Energiegewinnung umfunktioniert. Besonders Inga leidet unter diesem Verlust, da auch das Grab ihres Vaters nun unter Wasser liegt. Die Verbindung der Lappen zur Natur wird anschaulich und eindrucksvoll beschrieben, auch alle Frauenfiguren sind sehr stark mit hohem Identifikationspotenzial - durchaus auch feministisch zu lesen.
Am meisten beeindruckt hat mich aber wie die Autorin die systematische Zurückdrängung und Übergehung ihres eigenen indigenen, Volkes und ihrer Traditionen darstellt. Im Widerspruch dazu steht die raue Natur und vor allen Dingen die Verbundenheit der Samen oder besser gesagt aller Menschen mit ihr. Ich habe es also auch hauptsächlich als Mahnmal gelesen, wie kann man nur Profit orientiert oder wachstumsorientiert handeln und dabei seine Wurzeln völlig vergessen? Lesenswert für ein besseres Miteinander.
Zum Inhalt:
Immer im Frühling kehren Iŋgá, ihre Mutter und ihre Tante und den Rentieren in ihr Sommerland zurück. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn ihr Dorf ist nicht mehr da. Versunken mit allem ihrem Hab und Gut, selbst das Grab des Vaters, alles geopfert für die Wasserkraftproduktion. Ein jahrelanger Kampf beginnt.
Meine Meinung:
Ich muss gestehen, dass ich im Grunde nichts über die Geschichte der Samen wusste, jetzt zumindest so ein bisschen, wobei man dieses menschenverachtene Verhalten der Regierung den Samen gegenüber nicht nachvollziehen kann. Ich musste bei dieser Geschichte auch immer wieder an die Geschichte von Graun denken, dass dem Reschensee weichen musste, auch wenn diese Geschichte natürlich ganz anders ist. Denn hier geht es auch darum, dass die Beteiligten endlich ankommen wollen, was ihnen aber hartnäckig verwehrt wird. Bemerkenswert ist die Hartnäckigkeit zu verfolgen, was der Herzenswunsch ist gegen alle Widerstände. Auch das unterschiedliche Vorgehen von Mutter und Tochter in späteren Jahren hat mich nicht unberührt gelassen.
Fazit:
Keine leichte Kost
 Anja N, Buchhändler*in
Anja N, Buchhändler*in
Das Echo der Sommer
Von Elin Anna Labba
Ein sehr besonderes Buch, das sich intensiv mit der Kultur der Sami beschäftigt. Sprachlich hat mich das Buch sehr gefesselt. Keine leichte Kost.
Die 13jährige Iŋgá, ihre Mutter und Tante und die Rentiere, die Gruppe braucht nur das Tal in dem ihr Dorf ist. und das Grab des Vaters. Doch das diese Idylle wird ihnen genommen.
Es beginnt der Kampf gegen die Mächtigen.
„Elin Anna Labba erzählt die weitgehend unbekannte Geschichte ihrer Gemeinschaft und schafft ein unvergessliches Zeugnis für das Recht auf Selbstbestimmung und die tiefe Verbundenheit von Mensch und Natur. Ein hochaktueller Roman von ungeheuer erzählerischer Kraft.“
 Janina S, Rezensent*in
Janina S, Rezensent*in
Was weißt du über die Sami? Ich bisher nicht so viel – neben dem einladenden, sommerlichen Cover Grund genug, „Das Echo der Sommer“ von Elin Anna Labba zu lesen. Die Handlung dieses Romans erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte von den 1940er bis 1970er Jahren, die eigentlich vom immer gleichen Rhythmus geprägt sein sollten. Den Sommer verbringen Inga, ihre Mutter Rávdná und ihre Tante Ánne am See, fischen und verkaufen Kunsthandwerk an Tourist:innen. Jeden Herbst ziehen sie mit ihren Rentieren und dem Rest der Dorfgemeinschaft hoch in ihr Winterquartier nach Myra. Wenn da nicht die schwedischen Behörden, das Energieunternehmen und der Stausee wären. Immer wieder werden neue Seitenarme des ursprünglich stillen Sees geflutet, immer höher wird der Staudamm gebaut. Und immer wieder müssen die Sommerkoten der samischen Dorfgemeinschaft dran glauben. Egal wie hoch gelegen sie ihre neuen Torfkoten aufbaut, egal wie sicher sie sich eine zeitlang wähnt, irgendwann kommt jemand in einem fernen Büro auf die Idee, die Staulinie noch höher zu ziehen, zum Wohle der Allgemeinheit, also der Menschen im Süden, die ihren Strom benötigen. Den Sami wird dabei kein Mitspracherecht eingeräumt, warum auch? Sie seien ja ohnehin ein nomadisches Volk und bekannterweise von Natur aus nicht geschäftsfähig oder kreditwürdig. Daher wird ihnen auch gleich das Recht abgesprochen, „richtige“ Häuser zu bauen und sesshaft zu werden, und es werden behördliche Vormunde für sie bestellt, die „in ihrem Sinne“ amtliche Entscheidungen treffen sollen.
„Das Echo der Sommer“ beschreibt ein Schicksal, das viele indigene Völker teilen. Bevormundet, kleingemacht, entwurzelt, ihrer Kultur beraubt, mussten sie sich notwendigerweise weiterentwickeln und der modernen Lebensweise anpassen, was ihnen gleichzeitig aber so schwer wie nur irgend möglich gemacht wurde. Am Beispiel von Rávdná, Ánne und Inga, die jeweils ihren ganz eigenen Umgang mit den Umständen haben, kann sehr gut nachempfunden werden, was das für die Sami bedeutete. Es bricht einem das Herz, wenn gegen Ende des Romans eine Gruppe Sami im Speisesaal eines Altenheims beschrieben wird, die unruhig auf ihren Stühlen hin und her ruckelt, weil es Sommer und damit Zeit wird, in eine Heimat aufzubrechen, die es nicht mehr gibt.
Elin Anna Labba ist selbst Samin, studierte Journalistik sowie samische Kunst und Literatur und veröffentlichte 2020 zunächst ein Sachbuch über die Zwangsumsiedlungen der Sami, für das sie renommierte schwedische Buchpreise erhielt. Für ihren ersten Roman wünsche ich ihr auch international viel Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank an @s.fischer und @netgalleyde für das digitale Rezensionsexemplar.
tl;dr: Roman über das Schicksal der Sami in Nordschweden – stimmt betroffen und etwas resigniert.
Im Frühling kehren sie in ihr Sommerland am See im Nordwesten Schwedens zurück. Nur dieses Jahr ist es anders als gewohnt. Als die dreizehnjährige Ingá mit den Rentieren, Mutter und Tante das Tal erreicht, ist ihr Dorf versunken. Geopfert für die Wasserkraftproduktion und den Profit der Städte im Süden. Der nun beginnende Kampf gegen die Mächtigen des Landes stellt nicht nur die drei Frauen, sondern das ganze sámische Dorf vor eine Zerreissprobe. Elin Anna Labba hat ein hochaktueller Roman von ungeheuer erzählerischer Kraft geschrieben. Beim Lesen dieser grossartigen Geschichte bekommt man ein Bild der kulturellen und emotionalen Verluste, die durch diesen Entscheid angerichtet wurde. Die Schilderung der Betroffenen Menschen und ihre Verbindung zur Natur ist eindrücklich dargestellt. Mich hat diese Geschichte sehr beeindruckt. Gefallen hat mir, wie die Autorin, die die Stimmen der samischen Gemeinschaft authentisch und respektvoll einfängt. Das Buch hat bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Sehr empfehlenswertes Buch.
 Rezensent*in 780093
Rezensent*in 780093
Die schwedisch-sámische Journalistin und Autorin Elin Anna Labba greift in ihrem Roman „Das Echo der Sommer“ das Schicksal der Samen auf, deren Dörfer zugunsten der Energieversorgung der Städte geflutet wurden. Dabei bezieht sie sich auf die Erzählungen der Überflutung schwedischer Dörfer, die an den Quellseen des Stora Luleälvs liegen und anderer gefluteter Gegenden in den Jahren 1923, 1939, 1940-1944 und 1972.
„Wir sind am schönsten und schrecklichsten Ort der Welt gelandet“ sagt Rávdná zu ihrer dreizehnjährigen Tochter Iŋgá , als sie nach dem Winter in ihr Sommerland zurückkehren in ihre Kote hoch oben über dem Stausee, an dessen Hügeln sich sámische Dörfer angesiedelt haben. Dieser Stausee wird über Jahrzehnte hinweg in Etappen geflutet. Dabei ist es den Betreibern des Kraftwerks und letztendlich dem Staat nicht wichtig, dass die Sámi dabei ihr gesamtes Hab und Gut verlieren. Mehr noch, für sie gilt, dass sie als Nomaden kein Land besitzen dürfen und ihre Koten lediglich geduldet sind mit der Auflage, diese ausschließlich räumlich begrenzt in runder Form mit höchstens zwei Fensterluken zu bauen, zudem werden sie nicht an das nahe Elektrizitätswerk angeschlossen. Sie werden permanent ihrer Rechte beraubt.
Drei Frauen sind es, die dem indigenen Volk der Samen angehören, über deren Lebenswelten und deren Zwangsumsiedelung ich lese. Rávdná, Iŋgá und ihre Tante Anne. Sie sind fest verhaftet in ihrer traditionellen Lebensweise, sie sind kunsthandwerklich geschickt, sie verkaufen ihre Fellschuhe, ihre Brieföffner, Kaffeefilter und noch so einiges mehr an Touristen. Dagegen hapert es mit dem Lesen und Schreiben, lediglich Iŋgá beherrscht dies einigermaßen, was schon auch wichtig ist, auch wenn ein Beschwerdebrief an die zuständige Behörde nichts nützt. Nicht nur hier ist die Diskriminierung der Sámi deutlich zu spüren.
Obwohl das ganze Dorf mitsamt ihrer Kote im Wasser versinkt, wollen sie sich unter keinen Umständen vertreiben lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass der See geflutet wird. Sie wissen es aus Erzählungen der Älteren, als die erste Erhöhung des Staudamms gerade mal so hoch wie ein Haus war und nun erleben Rávdná, Iŋgá und Anne, Rávdnás Schwester, die neuerliche Flutung hautnah. Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass sie ihre Kote dem Wasser opfern müssen. Dabei kommt es mir so vor, als ob sie sich schon lange damit abgefunden haben, dass sie wieder und wieder aufs Neue ihre Behausung ein Stück weit höher den Berg hinauf errichten müssen. Sie leben ganz selbstverständlich im Einklag mit der Natur, sie folgen den Jahreszeiten und wollen es auch weiterhin so halten und nicht zuletzt auch darum kämpfen sie um ihren Lebensraum.
Elin Anna Labba hat mir eine Welt gezeigt, die mir vollkommen fremd ist. Sie lässt die sámische Sprache immer wieder kurz mit einfließen, was den Lesefluss lediglich anfangs etwas beeinträchtigt, da die Erklärung dazu dann wie nebenbei durchklingt. Das Buch lässt sich nicht einfach mal so weglesen, es fordert für sich ein gewisses Maß an Zeit ein. Die Diskriminierung indigener Völker – hier der Samen – ist hier anschaulich thematisiert, es ist ein lesenswertes Buch, das mich nachdenklich zurücklässt.
 Rezensent*in 715926
Rezensent*in 715926
Drei Frauen aus dem Volk der Samen, drei Generationen einer Familie, erzählen aus einem Teilbereich ihres Lebens. Den Sommer verbringen sie an einem Quellsee. Durch politische Entscheidungen kommt es dort zu Überflutungen, die eine Bedrohung für die ortsansässigen Bewohner darstellen. Neben ihren Habseligkeiten verlieren sie auch ihre Lebensgrundlage und Erinnerungsstücke. Eindrucksvoll befinden wir uns zusammen mit den Protagonistinnen inmitten einer abgelegenen Natur.
Das Buch ist trotz seines einfühlsamen Erzählstils keine leichte Lektüre. Viele Ausdrücke der Samen werden im Original verwendet. Einerseits ist das natürlich total authentisch, aber andererseits für mich nicht wirklich verständlich. Ich hätte mir am Ende des Buches eine Übersicht mit entsprechenden Übersetzungen oder Erklärungen gewünscht. Aber das Buch bewegt und gibt einen Einblick in das Leben eines mir nicht vertrauten Volksstammes, die in einer schwierigen Lage sind und das Schicksal indigener Völker auf anderen Kontinenten teilen.
Elin Anna Labba erzählt von Rávdná/Ragnhild, ihrer verwitwete Schwester Ànne und der 13-jährigen Ingà. Seit Generationen hatten die Frauen als Fischerinnen gearbeitet und ein paar Rentiere gehalten, weil es sich in der nomadischen Kultur so ergab. Sie lebten abwechselnd in ihrer aus Torf gebauten Sommerkote am See und in ihrer Winterbaracke. Rávdná verkauft darüber hinaus Schnitzereien und traditionelle Handarbeiten.
Ohne regelmäßige Unterstützung durch den verwitweten Elle Ànte (m) könnten die Frauen allein keine Rentiere halten. Als Mutter und Tante im Verlauf der Handlung körperlich schwächer werden und absehbar als Arbeitskräfte ausfallen werden, weckt die Veränderung Ingàs Existenzängste, die sich ein Leben ohne die Gemeinschaft der Sámi und die beiden Älteren schwer vorstellen kann. Wer nicht mehr arbeiten konnte, ging bisher traditionell in den See, da der Tod in der eigenen Hütte tabubehaftet war … Labbas Figuren altern im Verlauf verstörend schneller Szenenwechsel, ihr Verfall verläuft parallel zu den Umbrüchen in der Landschaft. Inga findet zwar Arbeit als Hausmädchen, wirkt ohne die ihr vertrauten Strukturen und Rituale jedoch ihr Leben lang entwurzelt.
Als ein Staudamm für ein Wasserkraftwerk gebaut und das Tal schrittweise geflutet wird, stoßen die Kulturen sesshafter Schweden und nomadischer Sámi aufeinander. Die Anwohner des Sees hatten gehofft, dass das Auffüllen des Tals Jahre dauern würde und nicht realisiert, dass es noch in der eigenen Lebenszeit abgeschlossen sein würde. Nun leben sie in Sichtweise eines Kraftwerks, dessen Strom sie nicht nutzen können, weil sie nicht Besitzer ihrer Grundstücke sind. Die Frauen haben keine Alterssicherung, ihr Vermögen steckt in Haus und Boot. Sie verlieren nicht nur das Grab von Ingàs Vater auf einer Insel im See, sondern ihre Kultur. Eine Torf-Kote ist nicht irgendeine Hütte, sondern Handwerkskunst und Ausdruck ihrer nomadischen Lebensweise, Rentieren hinterher zu ziehen. Mutter Rávdná, die bisher nur die Natur um Erlaubnis für ihr Handeln gefragt hat, realisiert nicht, dass das Land, auf dem ihre Kote steht, dem Staat gehört. Sie kann kaum Lesen und Schreiben und ist mit der „großen Sprache“ Schwedisch überfordert. Da die Sámi nicht sesshaft werden sollen, erhalten sie trotz Zwangsumsiedlung keinen Baukredit, ein Schildbürgerstreich der schwedischen Bürokratie.
Fazit
Ergänzend zum Dreieck aus Ann-Helen Laestadius „Die Zeit im Sommerlicht“, „Leuchten der Rentiere“ und Pylväinens „Das letzte Leuchten im Winter“ erzählt Elin Anna Labba vor dem historischen Hintergrund eines Staudammbaus vom erzwungenen Übergang eines nomadischen Volks in die Sesshaftigkeit. Am Schicksal dreier allein wirtschaftender eigenwilliger Frauen wird die Entfremdung von der eigenen Kultur und die Ignoranz des schwedischen Staates gegenüber der Sámi-Kultur deutlich.
LeserInnen dieses Buches mochten auch:
Bärbel Dr. med. Grashoff
Gesellschaft, Körper, Geist & Gesundheit, Sachbuch
Kira Gembri
Fantasy & Science Fiction, Kinderbücher