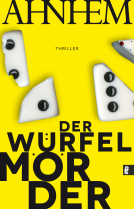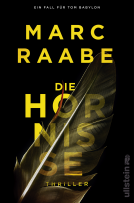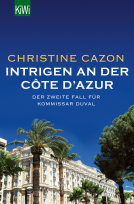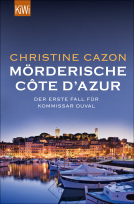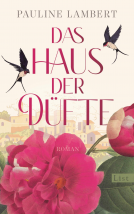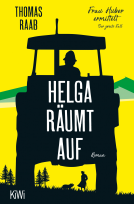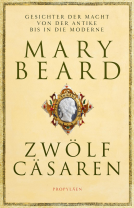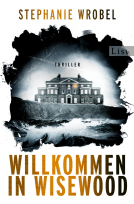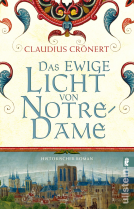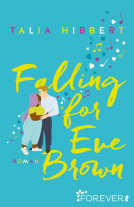ë
Roman. Shortlist Deutscher Buchpreis 2025
von Jehona Kicaj
Dieser Titel war ehemals bei NetGalley verfügbar und ist jetzt archiviert.
Bestellen oder kaufen Sie dieses Buch in der Verkaufsstelle Ihrer Wahl. Buchhandlung finden.
NetGalley-Bücher direkt an an Kindle oder die Kindle-App senden.
1
Um auf Ihrem Kindle oder in der Kindle-App zu lesen fügen Sie kindle@netgalley.com als bestätigte E-Mail-Adresse in Ihrem Amazon-Account hinzu. Klicken Sie hier für eine ausführliche Erklärung.
2
Geben Sie außerdem hier Ihre Kindle-E-Mail-Adresse ein. Sie finden diese in Ihrem Amazon-Account.
Erscheinungstermin 23.07.2025 | Archivierungsdatum 16.08.2025
Sprechen Sie über dieses Buch? Dann nutzen Sie dabei #ë #NetGalleyDE! Weitere Hashtag-Tipps
Zum Inhalt
Ein stilles und zugleich sprachmächtiges Buch, das vom Verlust der Heimat durch Krieg, von Schmerz und Sprachverlust erzählt. In diesem ergreifenden Debüt findet die Autorin eine großartige eigene...
Verfügbare Ausgaben
| AUSGABE | Anderes Format |
| ISBN | 9783835359499 |
| PREIS | 22,00 € (EUR) |
| SEITEN | 176 |
Links
Auf NetGalley verfügbar
Rezensionen der NetGalley-Mitglieder
So viele vergiftete Erinnerungen
Jehona Kicaj ist eine junge albanischsprachige Kosovarin, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt. Als ich im Herbst 1989 das erste Mal im damaligen Jugoslawien, in Dubrovnik, Urlaub machte, erfuhr ich auch zum ersten Mal vom Kosovo, von Kosovoalbanern, die ihre Identität nicht öffentlich machen wollten. Danach – in Deutschland war man gefühlt nur noch mit Mauerfall und Wende beschäftigt – begannen die Kriege, die auch das Kosovo und seine Bewohner zerstörten. Eine Flut von Flüchtlingen wurde in Deutschland aufgenommen, aber das wurde nicht so thematisiert wie jetzt, rund 34 Jahre später, der Ukrainekrieg. Für die Deutschen sind diese Kriege weit weg (gewesen). Aber die psychischen Traumata der Opfer und Vertriebenen, der Flüchtlinge klingen lange nach, werden uns noch lange begleiten. So, wie die Autorin heute davon berichtet, werden es später die Ukrainer oder Syrer sein, die ihre Erlebnisse und Wunden erst noch verarbeiten müssen.
Der Roman „ë“ hat wohl den kürzesten Titel, den ein Buch überhaupt haben kann, wenn man bedenkt, dass es teilweise in der albanischen Sprache auch noch ein stummer Laut ist, verschwindet er fast hinter der Geschichte. Und die spielt in der heutigen Zeit, man bemerkt es leider an der etwas aufgesetzt wirkenden geschlechtergerechten Sprache. Dabei ist es das Deutsch, dass offenbar in seiner Härte und Schwierigkeit der Ich-Erzählerin, vielleicht heißt auch sie Jehona, ein a am Ende des Namens ist sicher, einer Studentin, die sich einerseits mit der Heilung ihres verkrampften Kiefergelenks und andererseits mit den Erinnerungen an ihre Kindheit und die traurige Geschichte des Kosovo befasst, so sehr zu schaffen macht. Die auf Stress zurückgeführten Kiefergelenksbeschwerden lässt sie abwechselnd von einem Zahnarzt und einer Osteopathin behandeln, mit wenig Erfolg. Jehona will sich durchbeißen, sie ist und bleibt in der Diaspora, entkommt dabei weder ihren Gedanken noch ihren Gefühlen.
Der Leser erfährt Unbekanntes oder Vergessenes über den Kosovokrieg, der auch vor kleinen Kindern und Schulkindern nicht halt machte. Die Szenen sind bedrückend, lassen mich oft an die Ukraine denken, aber auch an den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen. Sehr anschaulich wird das besonders in den Seminaren der anthropologischen Forensikerin Dr. Joana Korner, die Jehona besucht. Hier geht es sehr ins Detail der mörderischen Verbrechen, die im Kosovo geschehen sind und von denen bei Weitem noch nicht alle aufgeklärt wurden. In einem der Seminare kommt auch der ehemalige Wohnort von Jehona, Suhareka, zur Sprache, seine etymologische Herkunft: „Der Ort, an dem die Sprache versiegt“, denkt Jehona, „daher komme ich also.“ Sie begreift ihre Schweigsamkeit, ihr Zurückgezogensein, ihre Introvertiertheit als Ergebnis ihrer Herkunft und ihres Schicksals. Aber sie wird dessen nicht Herr, nicht in diesem Buch.
Denn das Fremdsein hat immer zwei Seiten, zwei Richtungen, die eigene, die das Zentrum bildet, und die andere, alles Äußere Einschließende. Man kann von Jehonas Einzelflüchtlingsschicksal auf Geflüchtete und Schutz in anderen Ländern oder Regionen Suchende verallgemeinern, dass die Fremdheit sich auf Generationen ausdehnt, dass sie nie ganz verschwindet. Das betrifft in Deutschland die nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen und Geflüchteten ebenso wie jetzt die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine oder anderen Ländern. Oft schlagen ihnen Vorurteile, Unwillen oder Abneigung entgegen. Aber diese Menschen kommen auch mit eigenen Vorurteilen, oft einer gegensätzlichen Kultur oder Religion ins Land.
Sehr berührend sind die Szenen, in denen Jehonas Verwandte von Erlebnissen und Ereignissen während des Kosovokrieges erzählen, ihre Cousine Shpresa war auch noch ein Kind, als sie das alles erlebte. Jehona aber war mit ihren Eltern noch vor Ausbruch der schlimmsten Gewalt nach Deutschland geflohen. Alles, was sie weiß, erfährt sie aus zweiter Hand. Vielleicht liegt auch hier ein psychologisches Problem, die Schuld, dass ihr selbst nichts passiert ist. „Nur“ das Haus und die Heimat waren verloren. Daran beißt sie sich möglicherweise immer weiter die Zähne aus.
Für Jehona scheint die Zeit noch nicht reif, ihr Wissen, ihre Hintergrundgedanken, ihre Beweggründe für ihr Handeln und Denken mit anderen zu teilen. Selbst mit ihrem Freund Elias findet sie nicht immer eine Basis für ihre Gespräche, das stumme ë ist nicht nur ein Buchstabe, es ist Synonym ihrer im Mund gefrorenen Worte. Zerbeißen kann sie sie nicht.
Jehona Kicaj wird mit dem diesjährigen Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover (HANNA) für diesen Roman ausgezeichnet werden, aus meiner Sicht zu Recht. Diese Geschichten über Flucht, Vertreibung, Diaspora und Integration, von denen es viele gibt, sind sich immer sehr ähnlich, und doch ist ein jedes Schicksal individuell. Die Autorin macht das für den Leser zu einem Ereignis.
Fazit: Ein sehr nachdenklich stimmendes Buch, dass ich aufmerksam gelesen habe. Jehona Kicaj verwendet eine Sprache, die versucht klar und rein zu klingen, so wie sie als Kind versuchte, hundertprozentig gutes Deutsch zu sprechen. Und doch bleiben die Gedanken im Roman poetisch, wenn auch nicht immer nachvollziehbar.
 Rezensent*in 427080
Rezensent*in 427080
Der Ort, an dem die Sprache versiegt
Der Buchstabe, der dem Buch den Titel gibt, ist in der deutschen Sprache unbekannt. Er stammt aus derm Albanischen, der Muttersprache der Autorin wie der Erzählerin des Textes. Sie ist im Kosovo geboren, doch schon als Kinmd nach Deutschland gekommen. Die Sprache und die Sprachlosigkeit sind Thema des Buches wie auch das Trauma des Kosovokriegs und des Heimatverlust, den die Erzählerin verspürt.
Es ist kein einfacher Text, aber man merkt, wie sehr gut er recherchiert ist.
Es ist ein verhaltener Text. Was auserzählt wird, kann dennoch Leerstellen haben. Und doch gibt es viele Emotionen, die man als Leser erspüren und verarbeiten muss.
Am Ende kann ich ë ein bemerkenswertes Buch nennen!
Der Debütroman mit autofiktionalen Zügen von Jehona Kicaj ist keine leichte Kost. Das zeigt sich schon beim Buchtitel: ein Buchstabe aus der albanischen Sprache, ein e mit zwei Punkten drauf, das sich auf einer deutsch- oder englischsprachigen Standardtastatur nicht so leicht finden lässt. Ein sperriger Titel, einer, den man nicht so leicht nennen oder empfehlen kann, aber vielleicht genau deshalb passend für dieses sehr spezielle Buch und symptomatisch dafür, dass die, die in Mitteleuropa Zuflucht gefunden haben, sich nicht maximal an die deutschen Gewohnheiten anpassen müssen, um ja nicht aufzufallen. Buchtitel dürfen anders sein, genauso wie Namen... doch leider zahlen die Betroffenen oft immer noch einen Preis dafür.
Das zeigt sich zum Beispiel bei der Wohnungssuche, als die Ich-Erzählerin auf in perfektem Deutsch geschriebene Wohnungsanfragen, unterzeichnet mit ihrem eigenen, für deutsche Ohren fremd klingenden Namen, nicht einmal eine Antwort bekommt, während zwei Wochen später ihr deutscher Freund mit deutschem Namen auf die gleiche Anzeige sofort eine Antwort, eine Einladung und schließlich eine Zusage bekommt.
Das Thema Diskriminierung und auf Unverständnis stoßen, darum geht es ganz viel in diesem Buch: ob nun davon erzählt wird, als einziges Kindergartenkind unverkleidet zu einer Faschingsfeier zu kommen, weil niemand der Familie das für sie neuartige Konzept von Fasching erklärt habe, ob es um unsensibles Verhalten einer Studierendengruppe auf Studienreise im Kosovo geht, die für den Lehrveranstaltungsleiter als Andenken Souvenirs mit serbischen Symbolen aussuchen will, ob wieder mal Elias, der Partner der Ich-Erzählerin, nicht sehen kann, dass sie in vielem ganz andersartige Kindheitserinnerungen hat und viele Erfahrungen eben nicht mit ihm teilt, oder eine serbische Studienkollegin, vermeintlich eine Freundin, bei einer Party ein serbisch-nationalistisch wirkendes Lied spielt, woraufhin die Freundschaft stillschweigend zerbricht.
Dazwischen viele, viele Erzählungen über Traumata und Leid während des Kosovokrieges: wahre Geschichten, die der Familie der Ich-Erzählerin und deren Freunden und Bekannten zugestoßen sind, aber auch Berichte von Videobeweisen und Zeugenaussagen der vielen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in diesem schrecklichen Krieg geschehen sind, und die die Ich-Erzählerin und ihre Familie traumatisiert haben. Es entsteht das Bild einer bis heute zutiefst geschundenen Region, mit Menschen, die bis heute nach Verschwundenen suchen und hoffen, dass zumindest deren Leichen identifiziert werden können, und Dörfern, in denen jedes einzelne Haus niedergebrannt wurde. Ein sehr wichtiges Thema, das nicht in Vergessenheit geraten darf und zu dem dieses Buch einen wertvollen Beitrag leistet, auch wenn es stellenweise natürlich hart zu lesen ist.
Insgesamt ist es ein sehr flüssig und gut geschriebenes Buch mit vielen kleinen Geschichten über die Ich-Erzählerin und ihrer Familie, die so gestaltet sind, dass man sich der Familie nah und verbunden fühlt, sich für sie interessiert und gerne weiterliest. Ein bisschen schade habe ich gefunden, dass es in den vielen Geschichten so gut wie nur um Diskriminierung, Ausgrenzung, Enttäuschung und Nicht-Verstanden-Werden geht und es kaum Erzählungen des Verstanden-Werdens oder der Verbundenheit gibt - jedenfalls nicht außerhalb der Familie und Volksgruppe der Ich-Erzählerin, und mit Menschen anderer Nationalitäten. Egal, wem sie begegnet, (fast) alle Menschen begegnen ihr mindestens mit Unverständnis und Ignoranz, wenn nicht sogar mit offener Diskriminierung, und selbst vermeintliche Freundschaften stellen sich später als unecht heraus. Wahre, tiefe Verbindung und Liebe habe ich nur in der Beschreibung des Kontaktes zu Familienmitgliedern gespürt, etwa zur Cousine, die im Kosovo lebt.
Das macht mich beim Lesen bestürzt und traurig und ich frage mich, ob es in mehreren Jahrzehnten in Deutschland wirklich ausschließlich negative Erfahrungen gegeben hat, die die Ich-Erzählerin gemacht hat, ob ihr Fokus beim Erzählen dieser Geschichte (für andere, aber auch für sich selbst, als eigene Lebensgeschichte) bewusst darauf liegt und ob sich nicht auch ein bisschen mehr Verbindendes hätte finden können... ohne damit die Wichtigkeit, von Diskriminierung, Ausgrenzung und Leid zu erzählen, zu schmälern.
"ë" , der Debütroman von Jehona Kicaj ist keine leichte Kost aber absolut lesenswert.
Der Titel ë ist ein albanischer Buchstabe, ein häufig gebrauchter Buchstabe, Dieser Buchstabe ist stimmlos. Ebenso stimmlos wie die Protagonistin des Romans. In der Ich-Perspektive erzählt Jehona Kicaj aus ihrem Leben und ihrer Suche nach ihrer Vergangenheit. Sie ist als Tochter von Geflüchteten in Deutschland aufgewachsen, hat den Krieg im Kosovo nur aus der Ferne erlebt. Sie ist schüchtern, sehr schweigsam und knirscht nachts mit den Zähnen. Als sie ihr Studium beendet hat, begibt sie sich auf Spurensuche in ihrer Heimat.
Der Krieg im Kosovo 1998-1999 dürfte vielen Lesenden kein Begriff sein, hier empfiehlt sich einmal im Internet nachzuschauen. Der Roman selbst geht tiefer. Er beschreibt in eindringlicher Sprache nicht nur die Situation vor Ort sondern auch das Verhalten gegenüber Geflüchteten in Deutschland. Ich interpretiere das Zähneknirschen der Protagonistin, die im Schlaf so fest zubeißt, dass sie ihre Zähne nachhaltig beschädigt, als unbewusstes Verarbeiten eines Familientraumas, hervorgerufen durch den Krieg im Kosovo. Dieser Krieg wird von der Autorin über Unterhaltungen und Begegnungen mit ihrer Familie in Deutschland und im Kosovo erzählt. Auch die heutige Situation der Kosovoalbaner wird beschrieben ebenso die Grausamkeit dieses Krieges.
Kicaj schildert in einer Sprache, die einem wirklich unter die Haut geht und traurig macht. Ich würde mir wünschen, dass dieser Roman viele Lesende erreicht, um mit Vorurteilen aufzuräumen und eigenes Handeln zu überdenken.
Eine absolute Leseempfehlung von mir und verdiente 5 Sterne!
Gemeinsam mit ihren Eltern floh sie vor vielen Jahren nach Deutschland. Das Ankommen gestaltete sich schwierig und schon in Kindergarten begann für sie die Erfahrung des „Andersseins“. Stets war sie darauf bedacht, niemals aufzufallen und möglichst angepasst zu sein. Oft schweifen ihre Gedanken ab in die Vergangenheit. Denn ihre Heimat kann sie nicht vergessen.
Welch grausames Schicksal mussten die Menschen erleben, die im schrecklichen Krieg gegen Serbien angegriffen wurden. Realistisch und sehr emotional schildert die Autorin Jehona Kicaj in #ë die Erlebnisse ihrer Verwandten, die in Albanien geblieben sind. Neben den Ereignissen der Gegenwart berichtet die Ich-Erzählerin immer wieder auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Während des „Kosovo-Krieges“.
Ein Buch, das mich berührte und beschämte. Zu wenig interessierte mich damals das Schicksal der Betroffenen des Krieges. Aus dem Grund bin ich der Autorin sehr dankbar, dass sie mir auf diese Weise die Augen öffnete. Ich nehme das Buch als Anlass für das Lesen weitergehender Literatur. Für dieses Werk gebe ich sehr gerne eine Sternenregen. #NetGalleyDE
Ich fand das Buch sehr berührend und emotional aufwühlend. Es hat mir vom Inhalt her sehr gut gefallen, macht nachdenklich und wirft viele Fragen auf. Die Autorin versteht es mit Hilfe einer sehr detailreichen und besonderen Sprache, eine Nähe zum Leser herzustellen. Das Cover finde ich gelungen. Auch der Schreibstil ist sehr schön. Ich empfehle das Buch deshalb sehr gerne weiter.
 Rezensent*in 943268
Rezensent*in 943268
Der Buchstabe ë ist im Albanischen ein „Schwa“-Laut, also ein schwach betonter oder gar nicht ausgesprochener Vokal, ähnlich wie das letzte „e“ bei „Gedanke“. In verschiedenen, memoir-artigen Abschnitten, erzählt Jehona Kicaj in ihrem Debüt „ë“ von diesem Gefühl des Latenten, also etwas, das ähnlich wie dieser Buchstabe, zwar da ist, aber nicht ausgesprochen wird, nicht expliziert wird.
„Wenn man mich fragt, woher ich ursprünglich komme, möchte ich antworten: Ich komme von einem Ort, der verwüstet worden ist. Ich wurde in einem Haus geboren, das niederbrannte. Ich hörte Schlaflieder in einer Sprache, die unterdrückt wurde. Ich möchte antworten: Ich komme aus der Sprachlosigkeit.“
Die Erzählerin, die als Kind aus dem Kosovo geflohen ist, die ihre Zähne im Schlaf so fest aufeinanderpresst, dass sie kaputt gehen, die etwas, was überhaupt nicht da ist, mit ihren Knochen quasi zermalmt, erzählt uns davon, wie sie diesem Leiden auf den Grund zu gehen versucht. Sie erzählt uns von ihrer Kindheit und Familie, besucht die Vorlesung einer Forensikerin, die menschliche Knochen „zum Sprechen“ bringt und so Opfer des Kosovokrieges identifiziert, besucht Orte, die so verwundet sind, dass man sie mit Erinnerungen zum Sprechen bringen muss, um sie nicht zu vergessen. Erzählt von der Notwendigkeit und Anstrengung, die eigene Stimme nutzen zu müssen, um nicht von Zuschreibungen von außen verschluckt zu werden.
„Im Grunde bedeutet Sprechen für mich noch heute Nachahmung; es ist bloß eine neu angeordnete Klangabfolge von dem, was ich vorher gehört oder gelesen habe. Und manchmal frage ich mich, wie viel von mir selbst in meinen Worten liegt, wenn ich sie ursprünglich von gezeichneten Bildern auf dem Bildschirm erlernt habe.“
Der Kosovokrieg und die vorherigen Angriffe, die Unterdrückung und Segregation, serbischer Nationalismus, die orthodoxe Kirche und die Bestrebungen auf ein Großserbien - Kosovar*innen und ihren Lebensrealitäten wird in Deutschland nicht viel Raum geboten.
Umso schöner und beeinddruckender fand ich, dass der Sprachlosigkeit selbst etwas entgegengesetzt wird: In zahlreichen Dialogen sprechen Menschen, erzählen von ihren Erinnerungen an den Krieg und von ihren Gedanken und Meinungen zu verschiedenen Themen.
„M’doket e ke harru rrugën qysh me ardhë te na – ›Mir scheint, du hast vergessen, wie man zu uns kommt‹“
Auch der Sprache an sich gibt sie Raum. Sie denkt über das Verhältnis zu verschiedenen Sprachen nach, jenachdem, auf welche Weise man sie gelernt hat und welche Zuschreibungen sie von außen haben. Albanische Sätze werden oft ausgeschrieben (und anschließend übersetzt); man merkt, wie liebevoll Kincaj über das Albanische nachdenkt und wie sie versucht, diese Liebe an uns zu vermitteln, was mich als Leserin, obwohl ich diese Sätze nicht verstehe, emotional tief berührt hat.
„Manchmal frage ich mich, ob die Verspannungen in meinem Kiefer nicht auch auf die deutsche Sprache zurückzuführen sind. Ich bilde mir ein, dass meine Kiefergelenke an Tagen, an denen ich nur Albanisch gesprochen habe, weniger laut einrasten. Als hätte ich an diesen Tagen weniger Schmerzen. Wenn ich Deutsch spreche, habe ich das Gefühl, mein Kiefer müsste sich verrenken, um die Wörter auszusprechen, sie richtig zu betonen.“
Bei solchen Büchern fällt es mir schwer, Sterne-Bewertungen abzugeben, weil sie mir eben sehr memoir-haft und persönlich erscheinen. Was ich mir gewünscht hätte wäre, dass sich einige sprachliche Stilmittel, die am Anfang genutzt wurden, noch mehr durch das Buch gezogen hätten bzw. das Buch noch mehr angereichert hätten. Aber das ist nur eine kleine Anmerkung.
Ich empfehle ë für alle, die gerne etwas ruhigere, nachdenkliche und biografische Erzählungen lesen möchten.
Eine Besprechung auf meinem Instagram-Blog folgt zeitnah
Ein wunderschönes Buch einer Frau, die mit ihrer Familie aus dem Kosovo nach Deutschland floh. Dort lernte sie die Sprache und absolvierte schließlich ein Studium, ohne den Kontakt zur Heimat zu verlieren. Wir lernen viel über den Kosovo-Krieg und die vielen Opfer und Verletzungen, die er mit sich brachte. Das Buch ist in einem sehr poetischen Deutsch geschrieben und bedient sich einer klaren, sanften Sprache. Sehr empfehlenswert.
 Marius M, Bibliothekar*in
Marius M, Bibliothekar*in
Wie sich der Schmerz über Kriegsverbrechen bis in Körper hinein fortsetzen kann, das erkundet Jehona Kicaj in ihrem eindrucksvollen Debüt ë. Sie erzählt von den Gräuel des Kosovokriegs und den Auswirkungen, die dieser auf die Erzählerin bis heute nimmt – und von Zähnen, die zerrieben und bestimmt werden.
Vor wenigen Wochen gedachte man im Deutschen Bundestag am 30. Jahrestag dem Massaker von Srebrenica. Es war das schwerste Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg, bei dem achttausend muslimische Jungen und Männer von bosnisch-serbischen Truppen getötet wurden.
Obschon noch nicht lange her, sind die gewaltvollen Auseinandersetzungen, die unter dem Oberbegriff der Jugoslawienkrieg fast vor unserer Haustür stattfanden, heute zumindest aus dem kollektiven Bewusstsein hierzulande schon wieder weitestgehend verschwunden, auf dem hiesigen Buchmarkt wird das Thema eh nur als Randerscheinung behandelt.
Dass sich die Erinnerungen an die Verbrechen dieser Kriege aber in die Erinnerungen der Opfer des Krieges bis heute eingeschrieben haben, das zeigt Jehona Kicaj in ë eindrucksvoll.
Sichtbarstes Zeichen dieser Erinnerungen sind die Zähne und der Kiefer der Erzählerin. Denn sie knirscht derart stark mit den Zähnen, dass sich schon ein Splitter eines Zahns gelöst hat und der aufeinandergepresste Kiefer nur mit Druck und lauten Knackgeräuschen zu lösen ist. Obschon die Zähne zu den widerstandsfähigsten Teilen unseres Körpers zählen, droht der Erzählerin ein dauerhafter Schaden ihres Gebisses, weswegen sie einen Zahnarzt aufsucht, der ebenfalls alarmiert ist ob der rohen Kraft, die sich im Schädel der Erzählerin manifestiert.
Knirschende Zähne als Fortwirkung des Kosovokriegs
Die Gründe für dieses Knirschen und die Verspannungen ergründet Kicaj im Erinnerungstasten ihres Textes, der sich langsam vor uns Leser*innen entfaltet und preisgibt. Als Kind floh sie mit ihren Eltern vor dem Kosovokrieg, ehe die Gewalt dort völlig eskalierte.
Als albanische Minderheit hatte die Familie der Erzählerin eh schon kein leichtes Leben, was sich dann in den ethnischen Konflikten während der Jugoslawienkriege noch einmal potenzierte.
Feindlichkeit und Unterdrückung brach sie nun in roher Gewalt Bahn. Tötungen von Familien, Massengräber und Deportierungen der Albaner aus dem Kosovo in das Staatsgebiet Albaniens waren die grausamen Folgen in diesem Konflikt, dem die Erzählerin zwar räumlich entkommen sein mag, dessen Folgen aber auch in ihrer Familie und ihrem Körper noch fortwirken.
Wenn man mich fragt, woher ich ursprünglich komme, möchte ich antworten: Ich kommen von einem Ort, der verwüstet worden ist. Ich wurde in einem Haus geboren, das niederbrannte. Ich hörte Schlaflieder in einer Sprache, die unterdrückt wurde. Ich möchte antworten: Ich komme aus der Sprachlosigkeit.
Jehona Kicaj – ë, S. 11 f.
Sprachlosigkeit und Traumata
Das Ankommen in Deutschland, die Schwierigkeit, das Erlebte Menschen zu vermitteln, die diesen Konflikt nicht erlebt haben und der Umgang damit von der Grundschule bis hinein in die Studienzeit, in dem die Erzählerin dann mit einer Exkursion nach Prishtina in Serbien reist, all das blitzt in den Erinnerungen auf und vermittelt ein Gefühl für das, wofür es selten Worte gibt: Traumata und Verletzungen, Erinnerungen und ein angemessener Umgang mit dem Erlebten.
Stimmig erzählt Kicaj ausgehend vom Leitmotiv der Zähne von eigenen Verletzungen wie auch den Möglichkeiten, die die Arbeit mit Zähnen, sogenannten Odontogrammen, bietet. So war und ist die Identifikation über diese Zahnbilder ebenso verlässlich wie etwa ein DNA-Test und ermöglichte in der forensischen Aufarbeitung der Massaker viele Identifizierungen. Damit brachte die zahngestützte Arbeit der Forensiker den Angehörigen Klarheit über den Verbleib ihrer Vermissten – und der Beweisführung in der juristischen Aufarbeitung der Jugoslawienkriege wichtige Erkenntnisse und Belege.
Es ist ein motivischer Gang von vielen in diesem Buch, mit dem die Autorin vom Schicksal einer Überlebenden auf die Fortwirkungen der Gewalt vor Ort und die Bruchlinien zielt, die den Balkan seit dieser Zeit durchziehen. Zwar mögen sie nicht immer sichtbar sein, für die Betroffenen sind sie aber stets spürbar, auch wenn schon über zwei Dekaden seit den Gealtexzessen dort vergangen sein mögen.
Das ist eindrucksvoll erzählt und besticht durch den klaren Erzählton Kicajs, der souverän mit unterschiedlichen Motiven und Handlungsfäden vom Persönlichen bis zum Gesellschaftlichen spielt. Ihr gelingt ein Debüt, das den Blick auf den hierzulande schmählich unbeachteten Konflikt richtet und der sprachlich höchst ansprechend von Sprachlosigkeit und dem Unaussprechlichen erzählt.
Fazit
Gewalt, die sich in Körper und Erinnerungen eingeschrieben hat und der Umgang, dazu die Frage nach dem, was Wörter ausdrücken können, wenn sie doch eigentlich fehlen, das sind die die Themen, die Jehona Kicaj in ihrem Roman bravourös umkreist und sichtbar macht. Mit ë gelingt ihr ein fabelhaftes Debüt, das die Erinnerung an den Kosovokrieg wachhält und geradezu universell von Versehrung und Sprachlosigkeit nach dem Erleben solcherlei Gewalt erzählt, die bis heute fortwirkt.
Die Auflösung Jugoslawiens haben wir miterlebt, aber erfolgreich verdrängt. Eine kosovarische Studentin mit Bruxismus wird erfolglos von ihrem Zahnarzt behandelt, er gibt ihr den Rat psychologische Hilfe anzunehmen. Sie ist als Kind mit ihren Eltern aus dem Kosovo nach Deutschland entkommen. Die Verbrechen der Serben an ihrer Ethnie sind tief in ihr und damit ihr Problem. Jetzt und in Rückblicken taucht der Lesende mit ihr in diese Welt ein die selbst heute noch für Kosovaren voller täglicher Gefahren ist- nicht nur Minen sondern auch und gerade die sie beherrschenden Serben. Diese werden nicht ruhen bis das Erbe des Kosovo ausgerottet sein wird!
Die Ich-Erzählerin ist als Kind gemeinsam mit ihren Eltern aus dem früheren Jugoslawien, dem heutigen Kosovo, nach Deutschland geflohen. Den Krieg erlebt sie zwar aus sicherer Distanz, doch die Brutalität der Täter, die grausame Gewalt, die Vermissten und bis heute Verschwundenen – darunter auch ihr eigener Großvater – bleiben ihr stets gegenwärtig.
In Deutschland besucht sie Kindergarten, Schule und schließlich die Universität. Einerseits wächst sie als integriertes Mitglied der Gesellschaft heran, andererseits ringt sie darum, eine Sprache zu finden, die ihre Gefühle, Gedanken und ihre kulturelle Identität klar zum Ausdruck bringt.
Jehona Kicaj erzählt in e authentisch und mit großer Sensibilität von den erschütternden Vorkriegs- und Kriegserfahrungen im Kosovo. Ebenso eindrücklich schildert der Roman die mühsame Integration in ein neues Land – und den oft stillen, aber unermüdlichen Willen vieler Kinder aus Einwandererfamilien, „alles richtig zu machen“. Bei der Protagonistin führt dieser Druck dazu, dass sie sich in der Schule häufig nicht traut, Antworten zu geben, obwohl sie sie kennt.
e ist ein Roman, der eindringlich den Alltag Geflüchteter sichtbar macht – poetisch und zugleich politisch. Eine intensive, anspruchsvolle Lektüre, die lange nachhallt.
 Rezensent*in 942519
Rezensent*in 942519
"ë" ist der beeindruckende Debütroman von Jehona Kicaj, eine albanischsprachige Kosovarin, die in Deutschland aufgewachsen ist.
Wir kennen die Autorin als Studentin, als ihr während einer erfolglosen Zahnbehandlung, psychologische Hilfe empfohlen wird. So wird sie sich mit ihrer Vergangenheit mehr beschäftigen und wir erfahren viel mehr nicht nur über sie, sondern auch über den jugoslawischen Krieg aus 1989, die in Deutschland nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Jehona Kicaj erzählt aus der Ich-Perspektive ihr Leben als Flüchtling in Deutschland, wo sie physisch in Sicherheit war, psychisch aber weiterhin sehr belastet, da sie den Krieg durch die Nachrichten, die ihre Familie erreicht hat, miterlebt hat.
In "ë" beschäftigt sich die Autorin mit zwei großen Themen: Identität und Zugehörigkeit. Die Sprachen und die Welten, in denen sie lebt, sind sehr unterschiedlich und die Autorin ist eine leise Beobachterin und Erzählerin.
Genau wie "ë" ist auch die Arbeit der Autorin zwar leise, aber trotzdem wichtig und von großer Bedeutung. Jehona Kicaj macht bekannt, sowohl einige der Gräuel des Kosovokriegs, als auch die Ahnungslosigkeit einer anderen Welt. Zwischen diesen zwei Welten versucht die Autorin, ihre eigene Sprache und Stimme, ihre Identität, zu finden.
Ich finde "ë" ist ein wichtiges Buch, da man damit den Alltag geflüchteter Menschen kennenlernen und vielleicht verstehen kann.
 Buchhändler*in 1477326
Buchhändler*in 1477326
Jehona Kicaj widmet sich in ihrem Roman dem Kosovo-Krieg, einem noch aktuellen und dementsprechend brisanten europäischen Thema - aus der Perspektive der außenstehenden, jüngeren Generation. Die Erzählerin erinnert sich, greift Erinnerungen auf, forscht in der eigenen Familien-Vita und mischt sich als scheinbar unbeeinflusste Zuhörerin unter das überschaubare Publikum einer Vortragsreihe zur eigenen, unerforschten Vergangenheit. Neben dieser einprägsamen Konfrontation von Geschichtsschreibung und persönlicher Vergangenheit ist vor allem die Sprache ein wichtiges Mittel der Zuordnung und Abgrenzung (durch die Sprecherin oder ihr Umfeld). Serbisch und die Sprache der Bewohner des Kosovo stehen hier neben der deutschen Sprache, mit welcher sich die Autorin in ihrem Alltag ausdrückt. Die Sprache und der titelgebende Vokal sind prägend für ein Kommunikationsmittel, welches für die Ich-Erzählerin eine Sonderstellung hat, nicht alltäglich ist.
Neben dieser bemerkenswerten sprachlichen - also literarischen - Leistung hat der Roman inhaltlich eine große Brisanz. Der Kosovo-Krieg brachte Europa als Gemeinschaft an seine Grenzen und ist bis heute ein eher klein geredetes wie unabgeschlossenes Thema. Die Vermissten bleiben vermisst, endgültige Todeserklärungen bleiben aus. Und diese von Kicaj meisterhaft eingefangene Unsicherheit und Unabgeschlossenheit ist allgemein für den Umgang mit diesem Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte anzunehmen. Die Existenz in einem solchen luftleeren und teilweise nicht akzeptierten Raum (geographisch, politisch und auch emotional) verunsichert Betroffene und deren Kinder oder Verwandte. Jehona Kicaj gibt dieser Unsicherheit in ihrem Roman ein Gesicht und eine konkrete fiktive Gestalt - und damit einem ganzen Volk eine Stimme.
Und daher ist der Roman sowohl sprachlich als auch inhaltlich verdient auf der Shortlist des deutschen Buchpreises 2025 gelandet.
 Rezensent*in 683029
Rezensent*in 683029
Als Kind der 1990er ist der Kosovo-Albanien-Serbien-Krieg völlig an mir vorbeigezogen. Ich habe ihn schlicht nicht richtig wahrgenommen. Klar, die Geschichten hat man irgendwie so nebenbei erzählt bekommen, aber so richtig, wieso Krieg in Europa herrscht, wurde mit uns Kindern nicht besprochen. Und das obwohl auch meine Grundschulklasse ein Kind einer Flüchtlingsfamilie aufgenommen hat. Erst Jahre später habe ich verstanden, dass der neue Junge nicht blöd war und auch nicht unerzogen, sondern zutiefst traumatisiert und uns andere Kinder wahrscheinlich auch sprachlich nicht verstanden hat.
Genau diese Geschichte und diese Erfahrungen werden auch in diesem Roman erzählt. Eindringlich wird berichtet, wie sehr man von seiner Heimat entkoppelt werden kann und wie fremd man in der neuen dennoch bleibt.
 Bibliothekar*in 1146507
Bibliothekar*in 1146507
Der Kosovokrieg - wie beschämend, dass dieser Krieg so wenig in unserer Erinnerung und Aufarbeitung steht. Umso wichtiger, dieses Buch zu lesen und zu erfahren, was dort geschah und immer noch nicht aufgearbeitet ist. Aus der Sicht eines Mädchens, das dem Krieg entkommen ist und in Deutschland aufwächst und hier alltägliche Ausgrenzung aufgrund ihrer Herkunft erfahren und verarbeiten muss. Klare Leseempfehlung!